Aktuell
03.04.2025 BAG: Sonderkündigungsschutz für schwangere Arbeitnehmerinnen
-nachträgliche Klagezulassung
Erlangt eine Arbeitnehmerin schuldlos erst nach Ablauf der Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG Kenntnis von einer beim Zugang des Kündigungsschreibens bereits bestehenden Schwangerschaft, ist die verspätete Kündigungsschutzklage auf ihren Antrag gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 KSchG* nachträglich zuzulassen.
Die Klägerin ist bei der Beklagten beschäftigt. Diese kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 30. Juni 2022. Das Kündigungsschreiben ging der Klägerin am 14. Mai 2022 zu. Am 29. Mai 2022 führte die Klägerin einen Schwangerschaftstest mit einem positiven Ergebnis durch. Sie bemühte sich sofort um einen Termin beim Frauenarzt, den sie aber erst für den 17. Juni 2022 erhielt. Am 13. Juni 2022 hat die Klägerin eine Kündigungsschutzklage anhängig gemacht und deren nachträgliche Zulassung beantragt. Am 21. Juni 2022 reichte sie ein ärztliches Zeugnis beim Arbeitsgericht ein, das eine bei ihr am 17. Juni 2022 festgestellte Schwangerschaft in der „ca. 7 + 1 Schwangerschaftswoche“ bestätigte. Ihr Mutterpass wies als voraussichtlichen Geburtstermin den 2. Februar 2023 aus. Danach hatte die Schwangerschaft am 28. April 2022 begonnen (Rückrechnung vom mutmaßlichen Tag der Entbindung um 280 Tage).
Die Klägerin hat gemeint, die Kündigungsschutzklage sei gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 KSchG nachträglich zuzulassen. Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, die Vorschrift sei nicht einschlägig. Die Klägerin habe durch den positiven Test binnen der offenen Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG Kenntnis von der Schwangerschaft erlangt. Beide Vorinstanzen haben der Kündigungsschutzklage stattgegeben.
Die Revision der Beklagten hatte vor dem Zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Die streitbefangene Kündigung ist wegen Verstoßes gegen das Kündigungsverbot aus § 17 Abs. 1 Nr. 1 MuSchG unwirksam. Das Gegenteil wird nicht nach § 7 Halbs. 1 KSchG fingiert. Zwar hat die Klägerin mit der Klageerhebung am 13. Juni 2022 die am 7. Juni 2022 abgelaufene Klagefrist des § 4 Satz 1 KSchG nicht gewahrt. Diese Frist ist zwar mit dem Zugang des Kündigungsschreibens angelaufen. Der Fristbeginn richtete sich nicht nach § 4 Satz 4 KSchG*, denn die Beklagte hatte im Kündigungszeitpunkt keine Kenntnis von der seinerzeit bereits bestandenen Schwangerschaft der Klägerin. Die verspätet erhobene Klage war jedoch gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 KSchG nachträglich zuzulassen. Die Klägerin hat aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst mit der frühestmöglichen frauenärztlichen Untersuchung am 17. Juni 2022 positive Kenntnis davon erlangt, dass sie bei Zugang der Kündigung am 14. Mai 2022 schwanger war. Der etwas mehr als zwei Wochen danach durchgeführte Schwangerschaftstest vom 29. Mai 2022 konnte ihr diese Kenntnis nicht vermitteln. In der vom Senat vorgenommenen Auslegung genügt das bestehende System der §§ 4, 5 KSchG und des § 17 Abs. 1 MuSchG den Vorgaben der Richtlinie 92/85/EWG, wie sie der Gerichtshof der Europäischen Union in der Sache „Haus Jacobus“ (EuGH 27. Juni 2024 – C-284/23 -) herausgearbeitet hat.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 3. April 2025 – 2 AZR 156/24 –
Pressemitteilung 16/25
Vorinstanz: Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 22. April 2024 – 2 Sa 88/23 –
Anmerkungen: Rechtsanwalt Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lippstadt
24.04.2024 BAG: Betriebsratswahl - Weniger Kandidaten als BR-Sitze
Bewerben sich bei einer Betriebsratswahl weniger Arbeitnehmer für einen Betriebsratssitz, als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, kann ein kleinerer Betriebsrat gewählt werden.
In eine Klinik mit 170 Mitarbeitern haben sich lediglich drei Arbeitnehmer aufstellen und letztlich wählen lassen. Die „normale“ Betriebsratsgröße wären gem. § 9 S. 1 BetrVG 7 Betriebsratsmitglieder. § 9 BetrVG sieht eine Staffelung der Betriebsratsgröße entsprechend der wählbaren Arbeitnehmer vor. Sie beginnt mit einem Betriebsratsmitglied und wird dann, je nach Anzahl von wahlberechtigten Arbeitnehmern jeweils um zwei Mitglieder aufgestockt, so dass immer eine ungerade Anzahl an Betriebsratsmitgliedern entsteht.
Die Arbeitgeberin hielt die Wahl deshalb (nur drei, statt 7 Betriebsratsmitglieder) für nichtig und beantragte beim zuständigen Arbeitsgericht Hamburg die Feststellung der Nichtigkeit der Wahl.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Argumentiert wurde analog § 11 BetrVG. Die Größe des Gremiums sei entsprechend § 11 auf die nächstniedrigere Betriebsgröße zu minimieren.
Die Berufung der Arbeitgeberin vor dem Landesarbeitsgericht Hamburg scheiterte am selben Argument.
Der siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts wies auch die Revision zurück. Der Wahl eines Betriebsrats stehe nicht entgegen, dass sich nicht genügend Bewerber für den Betriebsrat aufstellen lassen. Der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers sei es, dass in einem Betrieb mit wenigstens fünf ständig wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, Betriebsräte zu bilden sind, § 1 Abs. 1 BetrVG. Entsprechend sei im Falle das weniger Kandidaten als zu besetzende Betriebsratssitze vorhanden sind, die Größe des Gremiums auf die jeweils nächst niedrigere Betriebsratsgröße gem. § 9 BetrVG zurückzugehen, bis die Zahl von Bewerbern für die Errichtung eines Gremiums mit einer ungeraden Anzahl an Mitgliedern ausreicht. Im Zweifle hätte also die Wahl mit nur einem gewählten Betriebsratsmitglied zu einem Ein-Personen-Betriebsrat geführt.
Quelle:
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 24. April 2024 – 7 ABR 26/23 –
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamburg, Beschluss vom 1. Februar 2023 – 5 TaBV 7/22 –
Anmerkungen: Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lippstadt
20.06.2024 BAG: Verarbeitung von Gesundheitsdaten – Medizinischer Dienst
In diesem Fall besteht die Besonderheit, dass der Kläger selbst Arbeitnehmer des Medizinischen Dienstes war, dessen Gesundheitsdaten von diesem Dienst verarbeitet wurden.
Der achte Senat stellt, nach Vorabentscheidung durch den EUGH, klar, dass die Verarbeitung von Gesundheitsdaten auch dann nach Art 9 Abs. 2 h) DSGVO zulässig sein kann, sofern der Betroffene selbst Arbeitnehmer des Verarbeiters ist.
Art. 9 Abs 2 h) DSGVO lässt die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten (…) erforderlich ist. Dabei müssen die Bedingungen und Garantien des Art 9 Abs 3 DSGVO gewahrt werden.
Der beklagte medizinische Dienst Nordrhein führt im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen ärztliche Begutachtungen zur Beseitigung von Zweifeln an de Arbeitsunfähigkeit gesetzlich Versicherte durch, und zwar auch dann, wenn es seine eigenen Mitarbeiter betrifft. Ein solcher Fall lag hier vor. In einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat ist ein Zugriffssystem geschaffen worden, welches den Anforderungen des Art. 9 Abs. 3 DSGVO entspricht.
Der Kläger war bei der Beklagten als Systemadministrator in der IT Abteilung beschäftigt und seit November 2017 ununterbrochen arbeitsunfähig. Ab Mai 2018 bezog der von seiner gesetzlichen Krankenkasse Krankengeld. Diese beauftragte im Juni 2028 die Beklagte mit der Begutachtung es Klägers zwecks Beseitigung an Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit des Klägers.
Eine bei der Beklagten angestellte Ärztin fertigte ein Gutachten, dass die Diagnose der Krankheit des Klägers enthielt. Dazu wurde von ihr im Vorfeld die telefonische Auskunft eines den Kläger behandelnden Arztes eingeholt. Dieser wiederum unterrichtete den Kläger von dem Auskunftsersuchen.
Der Kläger kontaktierte eine Kollegin aus der IT-Abteilung, die das Gutachten recherchierte, hiervon Fotos anfertigte und dem Kläger mittels eines Messengerdienstes übermittelte.
Daraufhin verlangte er immateriellen Schadenersatz auf Grundlage des Art. 82 Abs. 1 DSGVO von der Beklagten. Er berief sich darauf, dass seine Gesundheitsdaten nicht hätten von der Beklagten verarbeitet werden dürfen, sondern von einem anderen medizinischen Dienst. Die Ärztin sei nicht berechtigt gewesen Auskünfte von seinem Arzt einzuholen; die Sicherheitsmaßnahmen und die Archivierung sei unzureichend gewesen. Die Verarbeitung habe bei Ihm bestimmte – nicht näher bezeichnete – sorgen und Befürchtungen ausgelöst.
Der Senat hat in einer Vorabentscheidung den EuGH die Frage klären lassen, ob die Verarbeitung der Gesundheitsdaten des Klägers unionsrechtlich zulässig sei (EuGH C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein), insbesondere im Hinblick darauf, dass der Kläger selbst beim Verarbeiter (der Beklagten) beschäftigt ist. Der EUGH hat die Zulässigkeit der Verarbeitung der Daten des Klägers mit Hinweis auf Art 9 Abs. 2 h) DSGVO bestätigt. Im Wesentlichen seien die Voraussetzungen zur Zulässigkeit der Datenverarbeitung aufgrund von Art 9 Abs. 2 h DSGVO so streng, dass es einer weiteren Differenzierung dahingehend, ob ein eigener Arbeitnehmer des begutachtenden medizinischen Dienstes begutachtet wird, nicht notwendig sei.
In der Frage des Schutzes der Gesundheitsdaten hat der achte Senat die Maßnahmen der Beklagten als ausreichend erachtet, da einzig der unberechtigte Zugriff auf die Daten auf Initiative des Klägers erfolgte.
Anmerkung:
Es wird leicht übersehen, dass auch die besonders geschützten Gesundheitsdaten zulässig verarbeitet werden dürfen. Art 9 Abs. 2 h) ist nur eines der Beispiele. In der hier dargestellten Entscheidung kam der Beklagten zugute, dass Sie über eine Dienstvereinbarung die Rechtsgrundlage geschaffen hatte, welche im Zusammenhang mit der dazugehörigen Dienstanweisung die Sicherheitsanforderungen gem. Art. 9 Abs. 3 DSGVO erfüllten.
Quellen:
BAG: Urteil vom 20.06.2024 - 8 AZR 253/20 –
Vorinstanz LAG Düsseldorf 11.03.2020 – 12 Sa 186/19 –
Vorentscheid EuGH 21.12.2023 C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein
Anmerkung: Rechtsanwalt Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht
13.12.2023 BAG: Erschütterung des Beweiswerts von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (umgangssprachlich gelber Schein im Folgenden AU) ist geeignet den Beweis zu erbringen, dass eine Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers vorliegt. Dieser Beweiswert kann erschüttert sein, sofern eine Koinzidenz (Deckungsgleichheit) der Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit mit der noch offenen Kündigungsfrist besteht.
Dies gelte auch, wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach erhalt der Kündigung eine oder mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfassen und er unmittelbar daran eine neue Beschäftigung aufnimmt.
Im streitgegenständlichen Fall war der Kläger sei März 2021 bei der Beklagten als Helfer beschäftigt. Er legte am 02.05.2023 eine AU für den Zeitraum 02.05. – 06.05. vor. Der Arbeitgeber kündigte mit Schreiben vom 02.05.2023. Die Kündigung ging am 03.05.2023 zu.
Der Arbeitnehmer legte zwei Folgebescheinigungen vom 06.05. – 20.05. und vom 20.05. – 31.05.2023 vor. Am 01.06.2023 nahm er „arbeitsfähig“ eine andere Beschäftigung auf.
Die Arbeitgeberin verweigerte die Entgeltfortzahlung mit der Begründung, der Beweiswert der vorgelegten AU sei erschüttert, da die Zeiträume passgenau auf den Ablauf der Kündigungsfrist ausgestellt waren. Dem widersprach der Kläger und argumentierte, dass er bereits vor Zugang der Kündigung arbeitsunfähig gewesen sei.
Die Vorinstanzen (ArbG Hildesheim 26.10.2022 – 2 Ca 190/22 - / LAG Niedersachsen 08.03.2023 – 8 Sa 859/22 - ) gaben der auf Entgeltfortzahlung gerichteten Entgeltklage statt.
Der Fünfte Senat des BAG differenziert – zu Recht – zwischen der ersten AU und den beiden Folge-AU. Die erste Arbeitsunfähigkeit begann vor Zugang der Kündigung. Ihr Beweiswert war daher nicht anzuzweifeln. Für die Zeit vom 01.05. – 01.06.2023 war eindeutig Entgeltfortzahlung geschuldet.
Anders verhält es sich mit den beiden AU vom 06.05.2023 und vom 20.05.2023. Die Tatsache, dass die Zeiten genau auf die verbleibende Kündigungsfrist passen und im Anschluss direkt die Arbeitsfähigkeit beim neuen Arbeitgeber gegeben ist, geben die grundsätzliche Möglichkeit, der bisherigen Rechtsprechung zu folgen, dass der Beweiswert erschüttert sein könnte. Dies führt nach Ansicht des Senats dazu, das nunmehr der Arbeitnehmer den Beweis für die im Mai bestandene Arbeitsunfähigkeit auf andere Weise als durch Vorlage der ärztlichen Atteste zu führen hat.
Die Vorinstanzen haben, aus Ihrer Sicht konsequent, diese Frage nicht thematisiert. Aus diesem Grunde wird der Rechtsstreit an die Vorinstanz zur Aufklärung zurückverwiesen.
Anmerkung:
Es hat ja schon sehr lange gedauert, bis der Fünfte Senat im Jahr 2021 (08.09.2021 – 5 AZR 149/21 -) überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass eine passgenau attestierte AU gegebenenfalls nicht der beste Beweis für die AU sein könnte. Letztlich sollte man aber nicht vergessen. Die AU ist ein Attest, welcher ein Arzt ausstellt. Der Arbeitnehmer kann nach wie vor den Beweis seiner Arbeitsunfähigkeit führen, indem er den behandelnden Arzt als Zeugen benennt. Dieser wird sich bedanken. Letztlich wird ihm aber nichts anderes übrigbleiben, als die damals ausgestellte Arbeitsunfähigkeit im Zeugenstand zu bejahen. Der Fünfte Senat müht sich hier m. E. vergebens an der Unsitte der Krankschreibung im Anschluss an eine Kündigung ab.
Quelle: BAG-Pressemitteilung 45/23 zu BAG 13.12.2023 – 5 AZR 137/23 –
Rechtsanwalt Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lippstadt
14.09.2022 Kabinettsbeschluss Jahressteuergesetz 2022: Achtung PV-Anlagen!
Geplante Neuregelungen ab 01.01.2023 für Photovoltaikanlagen bis 30 kWp:
Umsatzsteuer wird auf 0% gesetzt. Ertragssteuer entfällt vollständig.
Das Gesetz muss vom Bundesrat in seiner Sitzung am 17.12.2022 noch bestätigt werden.
Dringender Handlungsbedarf besteht für diejenigen, die eine PV Anlage in 2022 noch in Betrieb nehmen wollen. Bitte wenden sie sich umgehend an ihren Steuerberater (Anmerkung des Unterzeichners)
Frank Heinemann, Rechtsanwalt Lippstadt
13.09.2022 BAG: Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit
Der erste Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) hat in seinem Beschlussverfahren mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung aus § 3 Abs. 2 Ziffer 1 Arbeitnehmerschutzgesetz - ArbSchG - in unionskonformer Auslegung der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen.
Folgerichtig konnte der antragstellende Betriebsrat nur unterliegen. Dieser wollte im Wege des § 87 Abs. 1 BetrVG eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeiterfassung durchsetzen. Da aber – nach Auffassung des ersten Senats – eine solche Pflicht aus § 3 Abs. 2 Ziffer 1 ArbSchG bereits gesetzlich besteht, ist, gem. § 87 Abs. 1 Eingangssatz, der Regelungsinhalt für eine Betriebsvereinbarung gesperrt. Dort können lediglich Regelungen getroffen werden, die nicht bereist aus Tarifvertrag oder Gesetz bestehen.
Interessant an dieser Entscheidung ist allerdings, dass der erste Senat erstmals die Auffassung verkündet, dass der Arbeitgeber – bei unionskonformer Auslegung - generell (da gesetzlich) verpflichtet sei, die Arbeitszeiten seiner Arbeitnehmer zu erfassen. Bisher war herrschende Meinung, dass lediglich Mehrarbeit und Arbeit am Wochenende / Feiertagen zwingend erfasst werden müssten.
Man wird die Entscheidungsgründe im vollständig abgefassten Urteil abwarten müssen um die Tragweite einschätzen zu können.
Würde man Sie dem Wortlaut nach weit auslegen so wäre für viele moderne Beschäftigungsverhältnisse (denke man in der IT oder im Support beispielsweise) die bisherige Praxis passe und man müsste wieder jede noch so kleine Arbeitseinheit erfassen. Hier bleibt es also spannend. Vorerst heißt es Arbeitgeber aufgepasst. Falls Arbeitszeiten nicht sowieso schon erfasst werden, dann wird es jetzt Zeit ein Modell zu finden, welches den wahrscheinlichen Ansprüchen des ersten Senates nunmehr gerecht wird.
Quelle: Pressemittelungen des BAG Nr. 35/22 vom 13.09.2022 zu 1 ABR 22/21
Anmerkungen: Rechtsanwalt Frank Heinemann
20.04.2021: Was tun, wenn ein Arbeitnehmer sich nicht testen lassen will?
Eine Corona Schnelltest Angebotspflicht für Arbeitgeber, wie er jetzt in der neuen Arbeitsschutzverordnung festgeschrieben wird führt in der Praxis immer wieder zu dem Problem, dass der Test-Angebots-Pflicht seitens der Arbeitgeber keine Testpflicht der Arbeitnehmer gegenübersteht.
Die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer nimmt die Testangebote an, doch einzelne sind nicht bereit den Test durchführen zu lassen. Wie kann der Arbeitgeber reagieren?
In einigen Bereichen ist eine Testpflicht angeordnet. Hier in NRW sind das beispielsweise die Lehrer und Schüler im Präsensunterricht (§ 1 Abs 2b Coronabetreuungsverordnung NRW). Besteht eine gesetzlich angeordnete Testpflicht für die Arbeitnehmer, so wird der Arbeitgeber, der sich weigert, sich testen zu lassen, kein ordnungsgemäßes Angebot seiner Arbeitskraft erbringen mit der Folge, dass auch die Entgeltzahlungspflicht des Arbeitgebers entfällt. Der Arbeitgeber kann darüber hinaus das komplette Arsenal arbeitsrechtlicher Konsequenzen ziehen. Das bedeutet, dass eine Kündigung nach Abmahnung hier erfolgversprechend sein dürfte.
Wo eine Testpflicht für den Arbeitnehmer nicht angeordnet ist, kommen widerstreitende Interessen ins Spiel: Auf Arbeitnehmerseite ist der Test immer ein körperlicher (medizinischer) Eingriff, der seiner Einwilligung bedarf. Auf der anderen Seite ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass in seinem Betrieb auch die anderen Arbeitnehmer geschützt sind. Zudem ist sei Interesse drauf gerichtet, einen Infektionsfall in seinem Betrieb zu vermeiden.
Eine Einzelfallabwägung ist in jedem Fall vorzunehmen.
Verallgemeinernd wird man allerdings das Überwiegen des Arbeitgeberinteresse in folgenden Fällen bejahen müssen:
Ein testresistenter Arbeitnehmer erscheint mit Erkältungssymptomen oder hatte er Kontakt zu einer Corona positiv bestätigten Person.
Mindestabstände / Mindestflächen können nicht eingehalten werden.
Der Mitarbeiter hat Kontakt zu Risikogruppen.
Der Mitarbeiter hat Kontakt zu Kunden.
Der Arbeitnehmer muss in einen Kundenbetrieb, der nur getestete Personen einlässt.
Schwieriger wird die Beurteilung in folgenden Fällen:
(Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeitnehmer keinerlei Kundenkontakt haben.)
Beispiel 1:
Der testresistente Arbeitnehmer sitzt in einem Büro mit drei weiteren Arbeitnehmern. Das Büro ist in kleiner, als es der vorgegebenen Größe für Personen entspricht (Bspw. 10 qm pro Person). Hier ist bereits das „Maske tragen“ Pflicht.
M. E. geht der Gesundheitsschutz der drei Kollegen hier vor, so dass ein Anordnungsrecht seitens des Arbeitgebers zu bejahen ist.
Beispiel 2:
Der testresistente gewerbliche Arbeitnehmer befindet sich in einer Montagehalle, welche ausreichend groß ist. Er arbeitet grundsätzlich allein. Zur Arbeitsausführung werden Anweisung vom Vorarbeiter erteilt. Die Qualitätssicherung schaut hin und wieder vorbei.
Hier wird die Beurteilung schwieriger. Könnte der Arbeitgeber den Arbeitsplatz so gestalten, dass der direkte Kontakt zu Kollegen vermieden werden kann, dann wäre ein Anordnungsrecht zu verneinen.
Beispiele 3:
Eine testresistente Mitarbeiterin hat ihr eigenes Büro, könnte Homeoffice machen, will dies aber nicht. Das Büro ist gut zu lüften und wird nur von ihr betreten.
Hier könnte man, wie im Fall 2, davon ausgehen, dass sämtliche Kontakte auch bei der Arbeit im Büro vermieden werden können. Die Weigerung im Homeoffice zu arbeiten könnte hier ebenfalls eine Rolle spielen. In einer Entscheidung aus 2018 hat das LAG Berlin Brandenburg (10.10.2018, 17 Sa 562/18) die einseitige Zuweisung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer im Homeoffice zu arbeiten abgelehnt. Das LAG argumentierte, dass die Arbeitsplätze im Büro und zu Hause so grundsätzlich verschieden sind, dass der Arbeitgeber nicht durch einseitige Zuweisung den Arbeitsort ins Homeoffice ändern kann. Im Fall war der Betrieb geschlossen worden. Der Arbeitgeber kündigte zu Unrecht, so das LAG. Ob die Entscheidung anlässlich der Corona Pandemie noch so getroffen würde, halte ich für zweifelhaft. Spätestens mit der Änderung der Arbeitsschutzverordnung mit Homeoffice Angebotspflicht für Arbeitgeber ist die Position des LAG von damals nicht mehr haltbar.
In allen drei Fällen ist allerdings zu überlegen, wo Begegnungen mit anderen Personen stattfinden (Weg zum Arbeitsplatz, Kantine, Umkleiden etc.). Kommt man zu dem Ergebnis, dass Begegnungen unvermeidlich sind, wird das Ergebnis der Abwägung in allen Fällen dahin führen müssen, dass das Interesse des Arbeitgebers an der Vermeidung eines Infektionsfall schon deswegen überwiegt.
Im Ergebnis wird man daher derzeit (Pandemie) in vielen Fällen begründet zu dem Ergebnis kommen, dass ein Anordnungsrecht des Arbeitgebers (sich testen zu lassen oder selbst zu testen) zu bejahen ist.
Frank Heinemann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Stand 21.04.2021
30.06.2022 Die Kanzlei Klein und Heinemann hat ihre Tätigkeit eingestellt
Bitte kontaktieren sie die Rechtsanwälte direkt
Rechtsanwalt Frank Hienemann, Kölner Grenzweg 52, 59558 Lippstadt, 02941-66961-0
Rechtsanwalt Eckart Klein, Hebbelstraße 5, 59555 Lippstadt, 0171-54939237
LAG Köln 15.12.2021: Quarantäne während Urlaub – keine Nachgewährung von Urlaubstagen
Die Klägerin hatte Urlaub. Als Kontaktperson ihres mit dem Coronavirus infizierten Kindes verfügte die zuständige Gesundheitsbehörde für sie eine Quarantäne. Die Klägerin behauptete, dass sie selbst innerhalb des Zeitraums positiv getestet sei, sie sei allerdings symptomlos geblieben. Ein ärztliches Zeugnis über die Arbeitsunfähigkeit legte sie aber nicht vor. Die Klägerin begehrt feststellen zu lassen, dass der Urlaub während ihrer Quarantäne als nicht genommen gilt.
Das Arbeitsgericht Bonn (07.07.2021 Aktenzeichen 2 Ca 504/21) hatte die Klage abgewiesen. Das nunmehr angerufene Berufungsgericht (Landesarbeitsgericht - im Folgenden LAG - Köln) hat dieses Ergebnis bestätigt. Die Klägerin hatte sich auf § 9 BUrlG bezogen. § 9 BUrlG regelt, dass jeder Urlaubstag, für den eine durch ärztliches Zeugnis nachgewiesene Arbeitsunfähigkeit vorliegt, nicht auf den Urlaub angerechnet wird. Diese Voraussetzung lag unstreitig nicht vor. Eine Gleichstellung der behördlichen Quarantäneanordnung mit einer nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit lehnte das LAG ab.
Eine Erkrankung mit dem Coronavirus gehe nicht automatisch mit einer Arbeitsunfähigkeit einher. Ein symptomloser Virusträger bleibe grundsätzlich arbeitsfähig. Die Quarantäneanordnung verbietet allerdings, die Arbeit aufzunehmen und durchzuführen. Eine analoge Anwendung des § 9 BurlG auf diesen Fall verneinte das LAG, da weder eine planwidrige Regelungslücke, noch ein mit der Arbeitsunfähigkeit vergleichbarer Fall vorläge.
Allerdings ließ das LAG die Revision zum Bundesarbeitsgericht zu.
Anmerkung:
Im vorliegenden Fall helfen auch die Entschädigungsregelungen des Infektionsschutzgesetzes – im Folgenden IfSG - nicht weiter. Jeder, der aufgrund einer Maßnahme des Infektionsschutzgesetzes (wie hier der Quarantäneanordnung) einen Schaden erleidet, erhält diesen gem. § 56 IfSG ersetzt. Im vorliegenden Fall muss das allerdings nicht geprüft werden, da ein materieller Schaden aufgrund der Bezahlung des Urlaubsentgelts (während des Urlaubs) nicht vorliegt. Man darf gespannt sein, ob Revision beim Bundesarbeitsgericht eingelegt wird. In einem vom Arbeitsgericht Aachen (Aachen 30.03.2021 Aktenzeichen 1 Ca 3196/209) verhandelten Fall wurde festgestellt, dass die Entgeltfortzahlung bei einer nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während einer angeordneten Quarantäne die Entschädigung nach dem IfSG verdrängt.
Der Einwand, die Klägerin hätte aufgrund der angeordneten häuslichen Isolation nicht den Arzt aufsuchen können, verwarf bereits das erstinstanzlich angerufene Gericht mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer telefonischen Anamnese durch einen Arzt mit darauffolgender Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (umgangssprachlich: telefonische Krankschreibung)
Quelle: Pressemitteilung 9/21 LAG Köln 15.12.2021 zu 2 Sa 488/21 (Ausgangsinstanz Arbeitsgericht Bonn 07.07.2021 2 Ca 504/21)
Anmerkung Rechtsanwalt Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lippstadt
29.09.2020: BAG: Verjährung von Urlaubsansprüchen?
Die Frage, ob der bezahlte Jahresurlaub der Verjährung unterliegt, hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts – im Folgenden BAG – als Vorabentscheidungsersuchen dem EuGH vorgelegt.
Zugrunde lag ein Fall einer Steuerfachangestellten, deren Arbeitgeber schriftlich bestätigt hatte, dass Ihr Jahresurlaub aus den Jahren 2011 und Vorjahren in Höhe von 76 Tagen am 31.03.2012 aufgrund außerordentlichen Arbeitsaufwandes nicht habe antreten können, nicht verfalle. Das Arbeitsverhältnis endete zum 31.07.2017. Der Arbeitgeber gewährte in den Jahren 2012 bis 2017 insgesamt 95 Tage Urlaub. Unstreitig besteht eine Jahresurlaubsanspruch von 24 Tagen. Die Klägerin macht (im Jahr 2018) insgesamt Urlaubsabgeltung für 101 Tage geltend. Im Verlauf des Prozesses erhebt der Arbeitgeber die Einrede der Verjährung.
Das LAG Düsseldorf hat der Klägerin 76 Tage Urlaubsabgeltung für den Zeitraum 2013 bis 2016 zugesprochen.
Für das BAG war entscheidungserheblich, ob der Urlaub aus den Jahren 2014 oder früher, der Verjährung unterliegt. Verfallen konnte der Anspruch aufgrund § 7 Abs. 3 BurlG nicht. § 3 Abs. 7 BurlG ist europarechtlich so auszulegen, dass der Arbeitgeber gehalten ist, den Arbeitnehmer auf den möglichen Verfall nicht genommenen Urlaubs nach Ablauf des Übertragungszeitraum rechtzeitig im Urlaubsjahr hinzuweisen. Diese Obliegenheit hatte der Arbeitgeber nicht erfüllt. Die Frage, ob der nicht verfallene Urlaub der Verjährung unterliegt, muss nunmehr der EuGH klären.
Quelle: Pressemitteilung Nr. 34/20 zu Beschluss BAG 29.09.2020 – 9 AZR 266/20 (A)
Frank Heinemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lippstadt
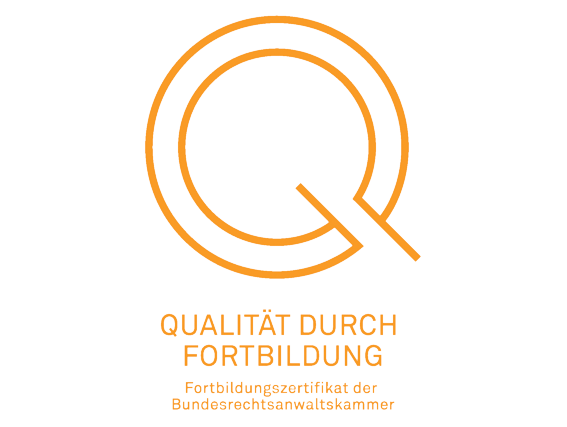
Mehrfach zertifiziert durch die Bundesrechtsanwaltskammer seit 09.01.2008
Da die Liste besuchten und derzeit gebuchten Fortbildungen und meiner Referententätigkeit zu einer langen Auflistung angewachsen ist, habe ich diese auf die Unterpunkte Fortbilungen/Referententätigkeit ausgegliedert.
